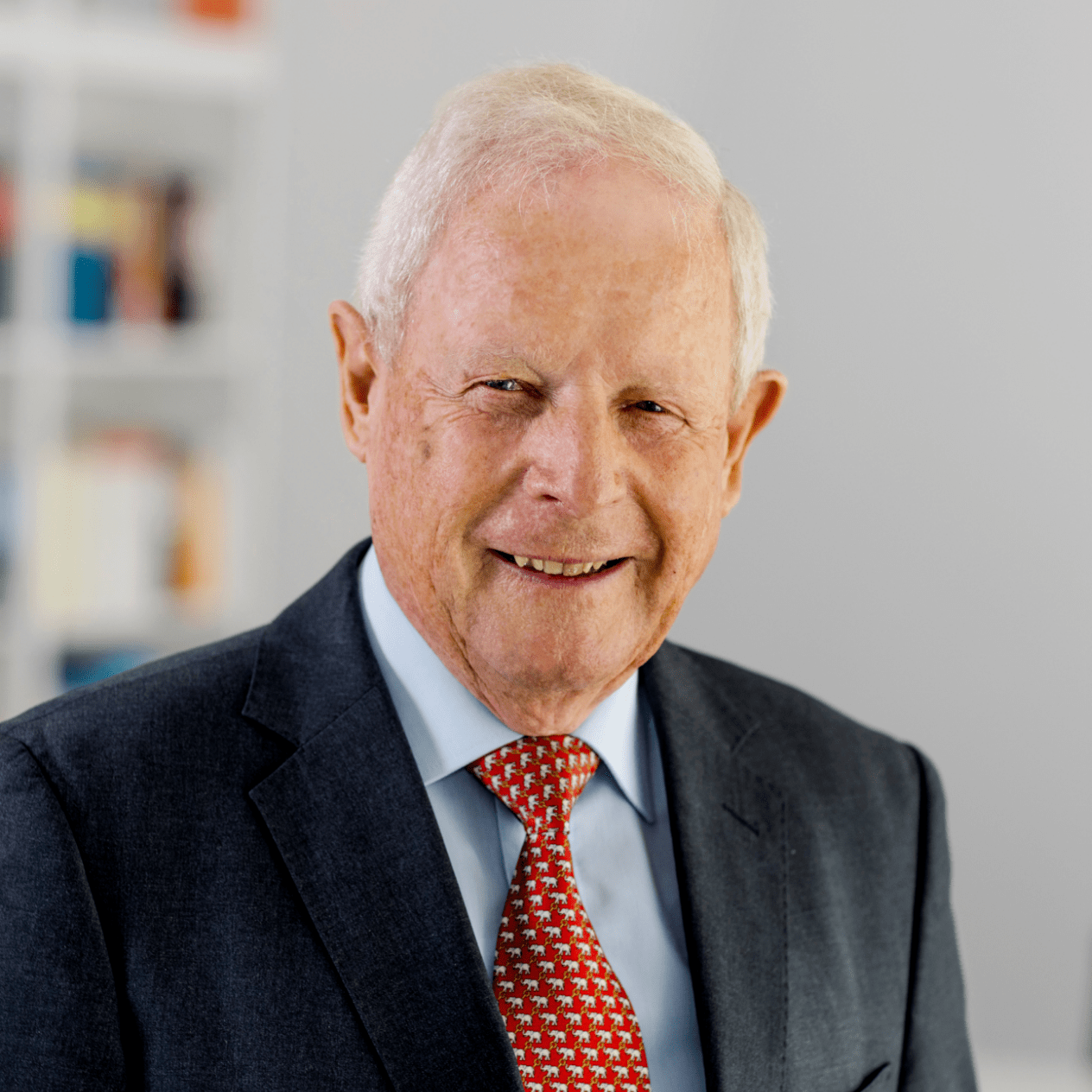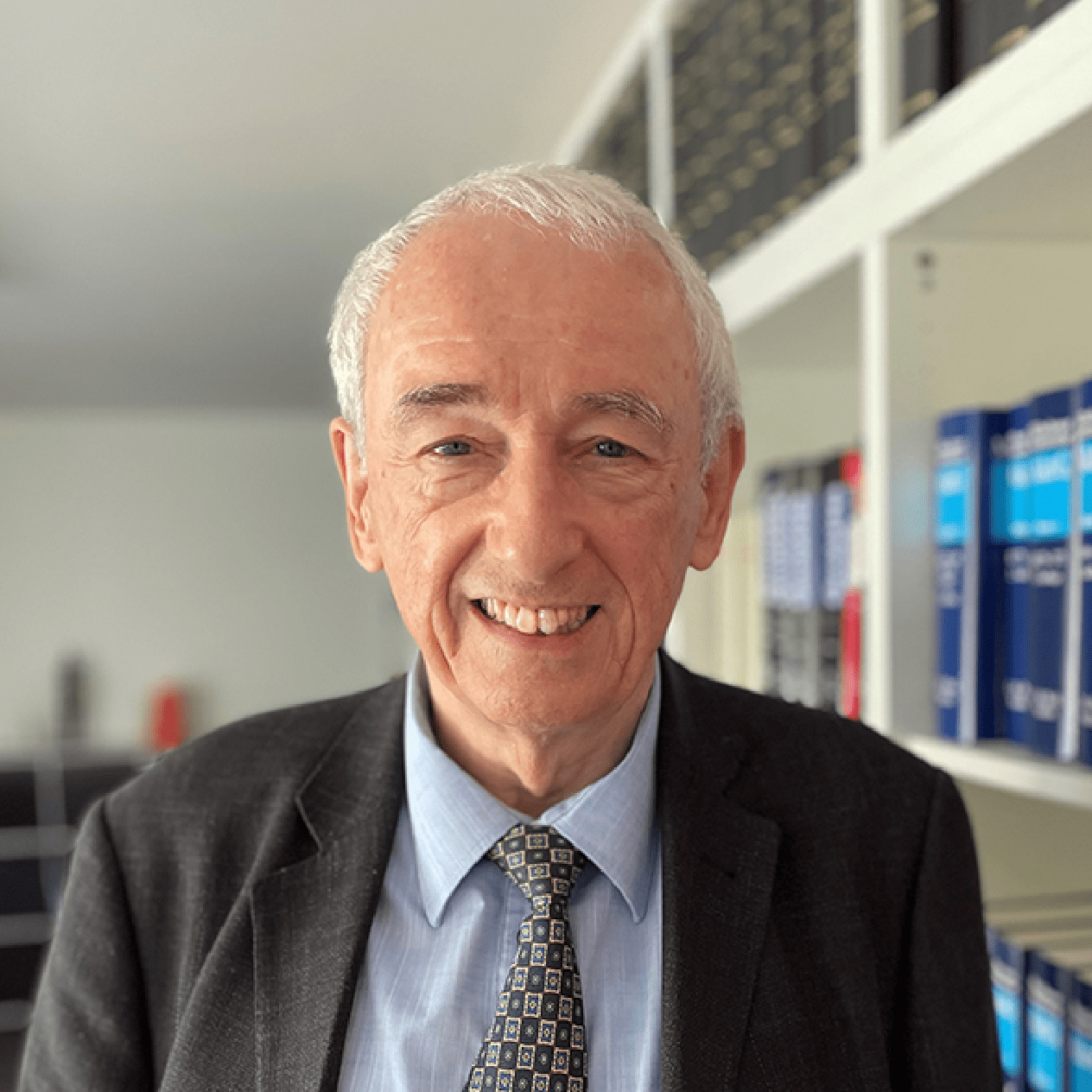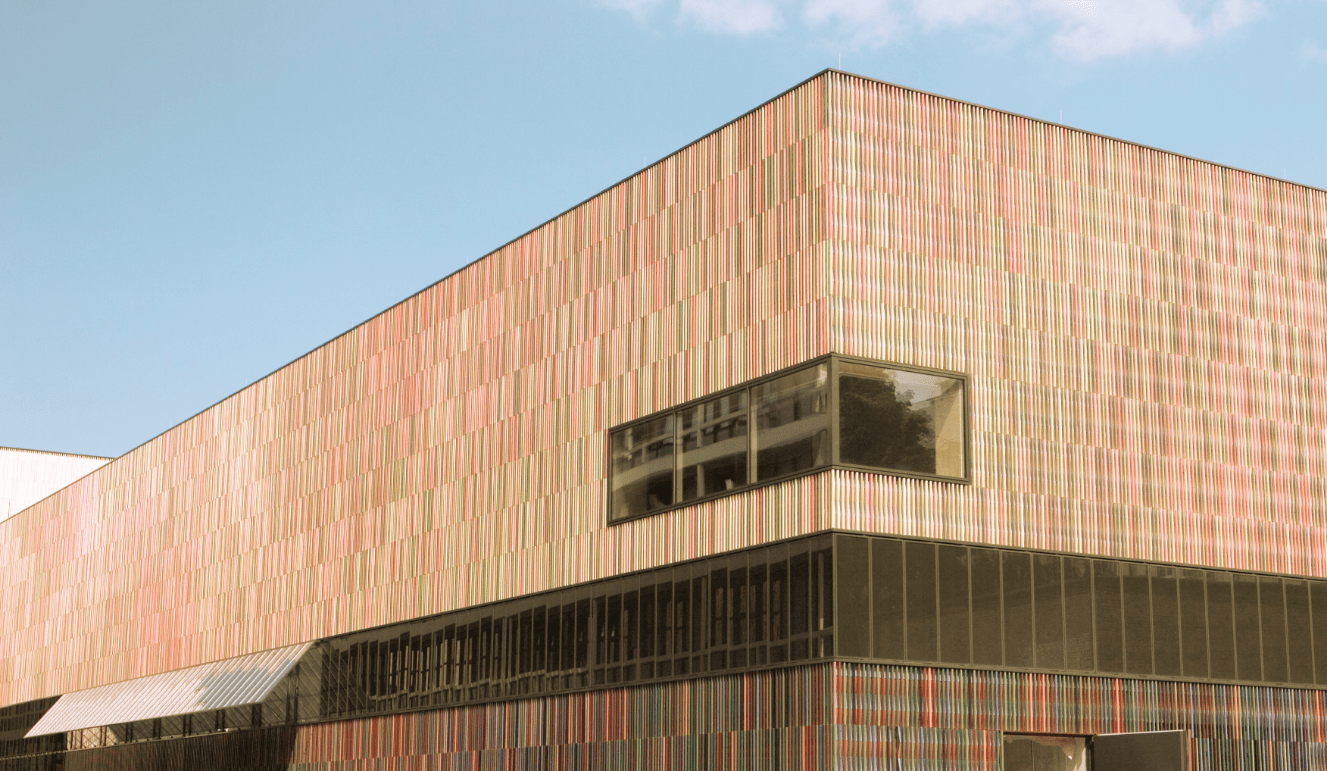Unsere Kanzlei ist seit über 40 Jahren in Münchens Innenstadt ansässig und bundesweit im Wirtschaftsrecht anerkannt. Wir sind das, was man eine Boutique-Kanzlei nennt.
Hochqualifizierte und spezialisierte Rechtsanwälte beraten und vertreten Sie in folgenden Bereichen und deren jeweiligen Schnittstellen:
- Arbeitsrecht
- Gesellschaftsrecht
- Prozessführung
- Erbrecht und Vermögensnachfolge
Unsere hohe Kompetenz und unser besonderes persönliches Engagement sind es, die unsere Auftraggeber überzeugen. Deshalb schenken uns viele unserer Mandanten schon seit langem ihr Vertrauen.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Mandanten das Gefühl haben, bei uns nicht nur einen, sondern ihren Anwalt gefunden zu haben.